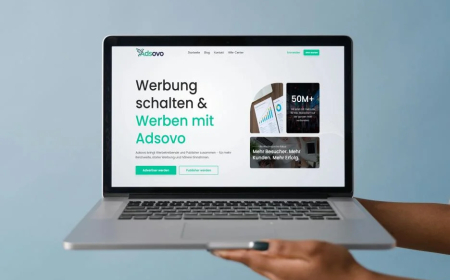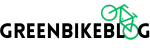Wie fahrradfreundlich ist Deutschland 2025? Der große E-Bike-Städteranking-Test
Wie e-bikefreundlich ist Deutschland wirklich? Ranking der besten Städte für Pedelec-Fahrer – mit Fokus auf Infrastruktur, Ladesäulen und Sicherheit.

Neue Mobilität braucht neue Maßstäbe
Deutschland versteht sich gerne als Fahrradnation – doch trifft das auch auf E-Bikes zu? Während klassische Radwege vielerorts etabliert sind, stellt der Boom der Pedelecs Kommunen, Planer und Verkehrspolitik vor neue Herausforderungen. Breitere Lenker, höhere Durchschnittsgeschwindigkeit, Ladebedarf und gestiegene Nutzung im Alltag verändern die Ansprüche der Radinfrastruktur erheblich.
Die Frage ist also: Wie gut ist Deutschland wirklich auf E-Bike-Fahrer eingestellt? Wo gibt es ausreichende Ladesäulen, sichere Wege, legale Abstellflächen und eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz? Und wo herrschen noch immer veraltete Strukturen, Konflikte mit Fußgängern oder fehlende Anbindung?
Dieser Beitrag analysiert die aktuelle Situation auf Bundes- und Stadtebene – mit Fakten, Nutzerstimmen und einem kritischen Blick auf die Entwicklungen bis 2025.
Das E-Bike als eigener Verkehrstyp
E-Bikes unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht vom klassischen Fahrrad: Sie sind schwerer, schneller und technisch komplexer. Das bedeutet auch: Sie brauchen andere Rahmenbedingungen. Während viele Städte auf Radwege mit 1,50 m Breite setzen, stoßen E-Bike-Fahrer auf Probleme – etwa beim Überholen, in engen Kurven oder bei Gegenverkehr.
Zudem sind Pedelecs vermehrt im Pendler- und Langstreckeneinsatz, wodurch sichere Stellplätze, durchgängige Routen und Lademöglichkeiten entlang von Arbeitswegen essenziell werden. Die Infrastruktur vieler Städte hinkt dieser Entwicklung deutlich hinterher – mit negativen Folgen für Sicherheit und Nutzererlebnis.
Ranking: Die e-bikefreundlichsten Städte Deutschlands
Basierend auf Daten aus der Mobilitätsforschung, E-Bike-Community-Befragungen, Ladesäulenverfügbarkeit, Unfallstatistik und Radwegeausbau ergibt sich folgendes Bild (Stand 2025):
Münster: Nach wie vor Vorbild mit durchgängigen Radtrassen, hoher gesellschaftlicher Akzeptanz, über 150 öffentlich zugänglichen Ladesäulen und E-Bike-Parkhäusern.
Freiburg: Klare Trennung von Fuß- und Radverkehr, besonders viele E-Mobilitätsprojekte, gut ausgebaute Wege ins Umland.
Karlsruhe: Mit dem Konzept „Radschnellweg“ Vorreiter bei schnellen Pendlerverbindungen. Ergänzt durch Ladepunkte und digitale Routenplanung.
Berlin: Trotz dichter Bebauung mittlerweile stark aufgerüstet. Viele Quartiersgaragen mit Lademöglichkeit, E-Bike-Leihsysteme, zunehmender Schutzstreifenbau.
Hamburg: Große Fortschritte in der Innenstadt, aber Probleme in den Außenbezirken. Positiv: Kooperation mit Sharing-Anbietern und Investitionen in Akku-Wechselstationen.
Schlusslichter im Vergleich bleiben Städte wie Gelsenkirchen, Ludwigshafen oder Wuppertal – hier fehlt es oft an durchgehenden Routen, moderner Ladeinfrastruktur und politischer Priorisierung.
Was E-Bike-Fahrer wirklich brauchen – und oft nicht bekommen
In Interviews mit E-Bike-Pendlern zeigen sich klare Wünsche: Durchgängige, breite Wege ohne Bordsteine oder Schlaglöcher. Sichere Stellplätze mit Ladesteckdose. Schutz vor Diebstahl. Digitale Navigation mit E-Bike-spezifischer Routenwahl (z. B. unter Vermeidung von steilen Anstiegen oder Kopfsteinpflaster).
Doch vielerorts fehlen selbst grundlegende Standards: Lücken im Radnetz, umständliche Umleitungen, keine Ausschilderung für E-Routen. Besonders ärgerlich sind „Radwege-Ende“-Schilder an Schnellstraßen – gerade für Pedelec-Fahrer, die auf Geschwindigkeit und Strecke angewiesen sind.
Ladesäulen: Versprochen – aber selten gefunden
Ein besonderes Thema ist die Ladeinfrastruktur. Zwar investieren Städte in E-Mobilität, doch meist geht es dabei um Elektroautos. Für E-Bikes fehlen flächendeckende Ladesäulen fast überall. Selbst in Großstädten finden sich nur punktuelle Angebote – meist an Verkehrsknotenpunkten oder Hochschulen.
Ein weiteres Problem: Viele Ladesäulen sind nicht überdacht oder schlecht beleuchtet – was den Ladevorgang in Herbst und Winter unattraktiv macht. Hinzu kommen inkompatible Stecksysteme, fehlende Kabel und teilweise kostenpflichtige Nutzung mit Anmeldung – ein Hindernis, das viele abschreckt.
E-Bike-freundliche Bundesländer: Wo die Politik funktioniert
Auf Landesebene zeigt sich ein gemischtes Bild. Vorreiter sind Baden-Württemberg und NRW mit gezielter Förderung von Radschnellwegen, E-Bike-Teststrecken und Förderprogrammen für E-Pendler. In Bayern und Hessen wiederum hängt viel vom kommunalen Engagement ab – hier gibt es Leuchtturmprojekte, aber kaum einheitliche Standards.
In Ostdeutschland investieren vor allem Städte wie Leipzig und Dresden verstärkt in Fahrrad-Infrastruktur – auch als Teil einer grünen Stadtentwicklung. Der ländliche Raum hingegen bleibt vielerorts unterversorgt – mit direkter Auswirkung auf das Mobilitätsverhalten.
Gesellschaftliche Akzeptanz: Konflikte und Lösungen
Ein unterschätzter Aspekt ist die gesellschaftliche Haltung gegenüber E-Bikes. Während jüngere Generationen E-Bikes als moderne, nachhaltige Fortbewegung begreifen, halten viele Menschen sie noch für „Rentnerräder“. Gleichzeitig kommt es immer wieder zu Konflikten mit Fußgängern oder klassischen Radfahrern – etwa bei Überholvorgängen oder an Ampelkreuzungen.
Städte, die gezielt auf Kommunikation, Kampagnen und E-Bike-spezifische Verkehrsführung setzen, können diese Spannungen deutlich reduzieren. Positivbeispiele sind Kölns „Fahrradstadt 2025“-Kampagne oder Hannovers Teststrecken für gemischte E-Bike-Pilotzonen.
Was Städte tun sollten – laut Experten
Fahrradplaner, Verkehrspsychologen und Mobilitätsexperten fordern eine klare Trennung: E-Bikes brauchen eigene Wege, eigene Parkzonen, eigene Regeln. Der Mischverkehr mit Fußgängern oder ungeschützten Radfahrern ist auf Dauer nicht tragfähig. Digitale Systeme wie Streckenführung per App, automatische Ladevorgänge und GPS-gestützte Navigation können die Nutzerfreundlichkeit erhöhen.
Langfristig braucht es eine „E-Bike-Strategie“, ähnlich wie sie für E-Autos längst existiert. Förderprogramme, Steueranreize, urbane Logistikprojekte und kommunale Leihsysteme mit Fokus auf Pedelecs wären ein echter Hebel für nachhaltige Mobilität.
Fazit: Fahrradfreundlich reicht nicht – es muss E-Bike-freundlich werden
Deutschland hat Fortschritte gemacht – aber nicht genug. E-Bikes sind nicht einfach „schnelle Fahrräder“. Sie sind ein eigenes Verkehrsmittel mit eigenen Bedürfnissen. Wer sie ignoriert, riskiert Stagnation statt Verkehrswende.
Nur wenn Infrastruktur, Politik, Gesellschaft und Technik aufeinander abgestimmt sind, kann das E-Bike sein volles Potenzial entfalten – für Pendler, Senioren, Sportler und alle, die nachhaltige Mobilität neu denken wollen.