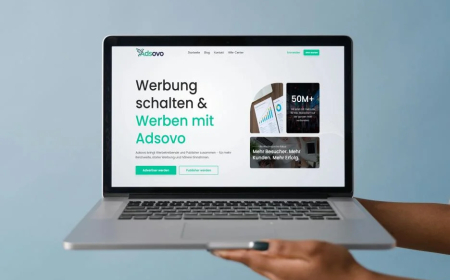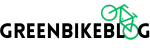E-Bike: Verkehrswende oder Risiko? Was Polizei, ADAC & Unfallforscher sagen
Mehr E-Bikes, mehr Unfälle? Was Polizei, ADAC & Forscher zur E-Bike-Sicherheit sagen – mit Daten, Trainings, Forderungen & Tempodiskussionen im Faktencheck.

Hoffnungsträger mit Schattenseiten
Das E-Bike gilt als Schlüssel zur Verkehrswende. Es soll Autofahrten ersetzen, Städte entlasten und Menschen zu mehr Bewegung motivieren. Millionen Deutsche steigen um – auf Pedelecs, S-Pedelecs oder E-Cargo-Bikes. Doch mit der rasanten Verbreitung steigen auch die Risiken: mehr Unfälle, unsichere Fahrmanöver, technische Ausfälle und eine Infrastruktur, die vielerorts nicht mithält.
Wie groß ist das Risiko wirklich? Was sagen Polizei, Unfallforscher und Verkehrsclubs zur aktuellen Lage? Ist das E-Bike ein Fortschritt – oder ein unterschätztes Sicherheitsproblem?
Dieser Beitrag wertet Zahlen, Stimmen und Analysen aus und stellt die Frage: Wie sicher ist die Verkehrswende auf zwei elektrischen Rädern?
Unfallzahlen im Überblick: E-Bike-Unfälle nehmen zu
Laut dem Statistischen Bundesamt wurden 2024 in Deutschland über 22.000 E-Bike-Fahrer bei Unfällen verletzt – rund 17 % mehr als im Vorjahr. Besonders auffällig: Der Anteil schwerverletzter und getöteter Personen ist im Vergleich zu herkömmlichen Fahrrädern deutlich höher. Die Gründe sind vielfältig:
-
Höheres Tempo durch Motorunterstützung
-
Höheres Gewicht der Räder, vor allem bei Bremsmanövern
-
Geringe Fahrpraxis vieler Umsteiger
-
Technische Defekte bei schlecht gewarteten Rädern
Unfallforscher wie Prof. Siegfried Brockmann vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) warnen seit Jahren: „Das E-Bike verzeiht weniger Fehler. Wer von einem normalen Rad umsteigt, muss sich neu orientieren – oder trainieren.“
Polizei warnt vor Selbstüberschätzung und mangelnder Schutzkleidung
Die Polizei stellt in Schulungen und Kontrollen regelmäßig fest: Viele E-Bike-Fahrer unterschätzen die Geschwindigkeit, mit der sie unterwegs sind. Vor allem ältere Nutzer glauben, das Fahrverhalten sei identisch mit dem eines klassischen Fahrrads.
Hinzu kommt: Der Helm ist bei Pedelecs (bis 25 km/h) nicht vorgeschrieben – wird aber laut Polizeiempfehlung dringend angeraten. Bei einem Unfall mit 25 km/h Aufprallgeschwindigkeit kann ein Helm den Unterschied zwischen Prellung und Schädelhirntrauma machen.
Viele Dienststellen bieten daher inzwischen spezielle E-Bike-Fahrsicherheitstrainings an – in Zusammenarbeit mit Verkehrswachten, ADAC oder TÜV. Besonders in Städten wie Hamburg, München oder Leipzig sind solche Programme sehr gefragt.
ADAC: Neue Mobilität braucht neue Regeln
Der ADAC beobachtet die E-Bike-Entwicklung differenziert. Einerseits lobt er den Beitrag zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs, andererseits warnt er vor überfüllten Radwegen, gefährlichen Mischverkehren und einer veralteten StVO.
In einer Stellungnahme aus dem Jahr 2024 fordert der Verkehrsclub:
-
Trennung von Fuß- und Radverkehr in Städten
-
Breitere Radwege für E-Cargo-Bikes und S-Pedelecs
-
Eine Kennzeichnungspflicht für S-Pedelecs mit klarer Abgrenzung zur Mofa-Regelung
-
Aufklärungskampagnen für sicheres E-Bike-Verhalten im Mischverkehr
Auch die Debatte um Tempolimits auf Radwegen wird lauter: Während klassische Fahrräder im Alltag selten über 20 km/h fahren, sind viele Pedelec-Nutzer konstant mit 25 km/h unterwegs. Auf engen oder schlecht ausgebauten Wegen steigt so das Unfallrisiko deutlich.
Unfallforschung der Versicherer (UDV): Fokus auf Infrastruktur
Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) legt in mehreren Studien nahe, dass nicht die Technik des E-Bikes das Problem sei – sondern die Umgebung, in der es genutzt wird.
Wichtige Erkenntnisse:
-
Radwege sind oft zu schmal und nicht für E-Bikes mit hoher Geschwindigkeit ausgelegt
-
Ampelphasen sind auf Autofahrer optimiert, nicht auf Radverkehr
-
Städte unterschätzen den Platzbedarf von Lastenrädern und S-Pedelecs
Die UDV fordert eine grundlegende Überarbeitung der Verkehrsplanung – mit Fokus auf E-Mobilität und neue Fahrzeugkategorien. Nur so könne man Unfälle vermeiden, bevor sie passieren.
Besondere Risiken für Senioren – und wie man ihnen begegnet
Ein Drittel der E-Bike-Nutzer in Deutschland ist über 60 Jahre alt. Für diese Gruppe ist das E-Bike eine enorme Bereicherung – aber auch eine Herausforderung. Die Reaktionszeit ist oft langsamer, das Gleichgewicht schlechter, die Körperkraft reduziert. In Kombination mit hohem Tempo entstehen gefährliche Situationen – besonders beim Anfahren, Bremsen oder Ausweichen.
Deshalb gibt es inzwischen auf Senioren spezialisierte Trainingsangebote – etwa vom ADFC oder von Kommunen. Tiefeinsteiger-Rahmen, ABS-Systeme und ergonomische Komponenten helfen zusätzlich, das Risiko zu senken.
Technik hilft – wenn sie richtig eingesetzt wird
Moderne E-Bikes verfügen über immer mehr Sicherheitsfeatures: ABS, Traktionskontrolle, automatische Lichter, Bremslichter, Blinker, GPS-Ortung. Doch nicht alle Nutzer kennen oder nutzen diese Technik effektiv.
Laut Bosch eBike Systems sind viele Unfälle vermeidbar, wenn Nutzer:
-
Die Motorunterstützung korrekt anpassen (z. B. im Stadtverkehr auf Eco-Modus)
-
Software-Updates regelmäßig durchführen (Sicherheitsfunktionen verbessern sich laufend)
-
Bremsverhalten bewusst trainieren (Stichwort: Vorderradnutzung, ABS-Auslösung)
In der Praxis bedeutet das: Technik kann schützen – aber nur, wenn sie verstanden und sinnvoll genutzt wird.
Verkehrsgerichtstag diskutiert Pedelec-Führerschein
Ein kontrovers diskutiertes Thema ist die Einführung eines verpflichtenden Pedelec-Trainings oder gar eines Führerscheins. Der Deutsche Verkehrsgerichtstag hat 2024 angeregt, zumindest für S-Pedelecs (bis 45 km/h) verpflichtende Schulungen einzuführen.
Argumente dafür:
-
Reduzierung der Unfälle durch Fahrfehler
-
Klare Abgrenzung zu Mofas und Mopeds
-
Verbesserung der Versicherungslage
Kritiker sehen darin jedoch eine Benachteiligung der E-Bike-Mobilität und einen Rückschritt in der Verkehrswende.
Fazit: Verkehrswende braucht mehr als Technik
Das E-Bike ist ein großer Gewinn für Umwelt, Gesundheit und urbane Mobilität – doch mit dem Fortschritt steigen auch die Anforderungen an Nutzer, Behörden und Verkehrsplaner.
Polizei, ADAC und Unfallforscher sind sich einig: Die Technik allein reicht nicht. Erst durch gezielte Aufklärung, bessere Infrastruktur und realistische Regeln wird das E-Bike vom Verkehrsrisiko zum echten Zukunftsmodell.